Am 19.6. hielt Frau Richterin am Amtsgericht Dr. Fuchs-Kaninski (zugleich Pressesprecherin des AG Köln) in der Vorlesung Strafrecht II im Rahmen des Programms „Justiz im Hörsaal“ einen Vortrag zur aktuellen Justizpraxis im Zusammenhang mit sog. Klimaklebern. Im Anschluss enstand eine lebhafte Diskussion mit und unter den Studierenden.
Aktuelles
Justiz im Hörsaal

Erschienen: UN Convention against Transnational Organized Crime
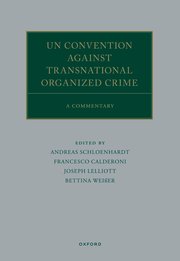
A Commentary
Edited by Andreas Schloenhardt, Francesco Calderoni, Joseph Lelliott, and Bettina Weißer
Oxford Commentaries on International Law
- Offers an article-by-article legal commentary on the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its three Protocols
- Documents the background, pre-existing treaties, and negotiations of the Convention and its Protocols, with references to official reports, judicial decisions, and academic literature
- Describes and analyses each provision under the Convention, the Trafficking in Persons Protocol, the Smuggling of Migrants Protocol, and the Firearms Protocol
- Documents all developments in the Conference of the Parties to the Convention and its Protocols
- Outlines and discusses the newly established UNTOC Review Mechanism
Bericht Gastvortrag Dr. Johanna Rinceanu, LL.M. (Washington, D.C.)

Am 23.05.2023 hielt Frau Dr. Johanna Rinceanu, LL.M. (Washington, D.C.) einen Vortrag zu dem Thema „Vom NetzDG zum DSA – Menschenrechte in der digitalen Krise“ in der Gesprächsreihe Internationales Strafrecht. Frau Dr. Rinceanu ist Senior Researcher in der strafrechtlichen Abteilung des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg i. Br.
Nach einer Einführung in die transformative Kraft sozialer Medien, die als Infosphäre sowohl Selbst- als auch Fremdwahrnehmung verändere, stellte die Vortragende das 2017 in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), den deutschen Versuch einer Regulierung sozialer Medien, dar. Ziel des Gesetzes sei die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und eine Veränderung der Debattenkultur in sozialen Netzwerken durch private Akteure. Zur Erreichung dieses Ziels richte sich das NetzDG an Anbieter sozialer Netzwerke mit mehr als zwei Millionen monatlichen Nutzern im Inland, die ua nach einem „Notice-and-Takedown-Modell“ verpflichtet würden, Hassreden, Fake News und andere rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen nach einer Beschwerde innerhalb von 24 Stunden bzw. innerhalb von sieben Tagen zu löschen oder zu sperren. Problematisch sei insbesondere, die Auferlegung einer Meldepflicht, nach der IT-Diensteanbieter dem BKA zur Ermöglichung der Verfolgung von Straftaten Inhalte übermitteln, die dem IT-Diensteanbieter in einer Beschwerde gemeldet worden sind und die von ihm entfernt oder gesperrt wurden. Die Nutzer würden frühestens vier Wochen nach der Übermittlung der Daten an das BKA über die Übermittlung informiert.
Die Vortragende machte darauf aufmerksam, dass das NetzDG die Rechtsdurchsetzung größtenteils privaten profitorientierten Unternehmen übertrage. Dadurch entziehe sich der Rechtsstaat seiner Verantwortung und nehme massive Einschränkungen der Meinungsfreiheit, aber auch der Berufsfreiheit, in Kauf. Frau Dr. Rinceanu konzentrierte ihre Ausführungen im Folgenden auf die in Art. 19 Abs. 1 IPbpR, Art. 10 EMRK, Art. 5 GG verankerte Meinungsfreiheit. Durch die Verpflichtung privater Anbieter zum Entfernen rechtwidriger Inhalte entstehe eine private Paralleljustiz, durch die eine Gefährdung der Meinungsfreiheit und damit auch des demokratischen Diskurses strukturell angelegt sei. Durch die voraussichtliche Ablösung des NetzDG durch den Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union ändere sich die Regulierungslage kaum – der „Notice-and-Takedown-Mechanismus“ bleibe mit Blick auf „rechtswidrige Inhalte“ (Art. 3 (h) DSA) bestehen. Damit sei weiterhin ein Overblocking, und ein Overfiltering zu erwarten. Frau Dr. Rinceanu hielt dem entgegen, Medienregulierung müsse anders, von einer „Netiquette“ der Toleranz, des Pluralismus, der Gleichberechtigung und des Respektes der Vielfalt gedacht werden. Notwendig seien daher ein Dialog zwischen Gruppen, aktiver Widerspruch gegen Hasskommentare, Gegenrede und eine an den Grund- und Menschenrechten orientierte Bildung.
Im Anschluss an den Vortrag entstand eine lebhafte Diskussion über Sinn und Nutzen der geltenden Plattformregulierung in Deutschland, Regulierungsalternativen wie sie etwa in den USA gelten, Grenzen der Meinungsfreiheit und präventive Ansätze für einen schonenderen Interessenausgleich.
Christine Untch
Bericht Lesekreis während der "verbrannt und verbannt" Aktionswoche
Im Rahmen der Köln-weiten Aktionswoche „verbrannt und verbannt“ zum 90-jährigen Gedenken an die Opfer der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten veranstalteten Laura Midey und Max Wrobel vom Institut für ausländisches und internationales Strafrecht am 11. Mai 2023 einen Lesekreis mit Texten von und über Rudolf Olden.
Rudolf Olden war Jurist und Journalist in der Weimarer Republik. Als Strafverteidiger hatte er ein Auge für politisch brisante Fälle. So setzte er sich für die Wiederaufnahme im Fall Jakubowski ein – nicht nur, weil dieser auf unsicherer Beweisgrundlage zum Tode verurteilt worden war, sondern auch, um anhand dieses Einzelfalls gegen die Todesstrafe im Allgemeinen ein Zeichen zu setzen. In weiteren Prozessen verteidigte Olden Whistleblower, die den völkerrechtswidrigen Ausbau der Reichswehr gemeldet (Fall Bullerjahn) und Journalisten, die darüber berichtet hatten (Fall Weltbühne) gegen den Vorwurf des Landesverrats und der Spionage – ganz im Sinne seiner politischen Überzeugungen: Pazifismus, internationale Solidarität, Völkerrecht statt Krieg und Militarismus; rechtsstaatlich-demokratische und freiheitliche Republik statt obrigkeitsstaatlicher Monarchie.
Anhand Oldens biografischer Texte über Hindenburg und Hitler vollzogen Studierende und Doktoranden den historisch-politischen Kontext von Kaiserreich, Weimarer Republik und NS-Machtübernahme. Olden analysierte Kontinuitäten zwischen den Systemen: Der totalitäre Militarismus Preußens, der das Kaiserreich dominiert, dem Verwaltung und Justiz auch in der Weimarer Republik treu bleiben und den die Nationalsozialisten schließlich auf die Spitze treiben. Und heute? Nicht zuletzt aufgrund des neuen § 5a RichterG ging es in der Diskussion auch um die Frage, wie sich eine Auseinandersetzung mit dem Unrecht vergangener Zeiten in das juristische Studium integrieren lässt. Dass dabei auch Verfechter eines freiheitlich-demokratischen Rechtsverständnisses als Vorbilder und Vertreter einer verbannten und teils vergessenen Rechtskultur eine Rolle spielen sollten, zeigt die Beschäftigung mit Rudolf Olden eindrücklich.
Laura Midey
Eine Lesekreisveranstaltung zum 90-jährigen Gedenken an die Bücherverbrennung

•Worum geht es?
–Wir lesen und diskutieren Texte zum Thema: Widerstand der Juristen gegen den Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, insbesondere: Rudolf Olden
•Wann und wo findet es statt?
–11. Mai 2023, 19:30 Uhr
–Seminargebäude (Uni Köln, Albertus-Magnus-Platz), Raum S 15
•Wie könnt ihr mitmachen?
–Anmeldung via Mail an: lmidey1uni-koeln.de
–Mit der Anmeldebestätigung erhaltet ihr den Reader zum Lesekreis
–Wählt die Texte, die euch besonders interessieren, lest sie vorab und bringt eure Fragen und Gedanken in der Diskussion ein: Die Debatte lebt gerade von der Perspektive der Studierenden!
–Weitere Infos findet ihr hier.
Gastvortrag Dr. Johanna Rinceanu, LL.M. (Washington, D.C.)

Das Institut für ausländisches und internationales Strafrecht lädt ein:
Gastvortrag von Dr. Johanna Rinceanu, LL.M., Senior Researcher in der strafrechtlichen Abteilung des MaxPlanck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg
Titel: Vom NetzDG zum DSA: Menschenrechte in der digitalen Krise.
Datum: 23.05.2023
Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Cologne International Forum (International House, Kringsweg 6)
Wir bitten um kurze Anmeldung via internationales-strafrecht@uni-koeln.de
Report Guest Lecture Andrés Ritter

On 23 January 2023, Andrés Ritter, the German European Prosecutor and Deputy European Chief Prosecutor at the European Public Prosecutor's Office (EPPO) in Luxembourg, visited the Institute for Comparative Criminal Law. In the premises of the Cologne International Forum, Mr. Ritter delivered a lecture as part of the Institute's talk series on international criminal law. The lecture was simultaneously an event within the collaborative project "Transnational Organised Crime: Organised Crime, Criminal Procedure, and Prisons" of the Universities of Queensland (Australia), Ferrara (Italy), Vienna (Austria), Zurich (Switzerland) and Cologne, in which research is conducted on transnational organised crime.
"The European Public Prosecutors Office – Background of the first supranational prosecutor's office and its relevance in the fight against organised crime" was the title of Mr. Ritter's presentation. After some welcoming words and a brief introduction into the topic by Prof. Dr. Weisser, Mr. Ritter started his lecture with an introduction to the history, competences, structure and role of the EPPO. A special emphasis was placed on the challenges the EPPO has faced and still faces since the idea was first proposed in 1995 - opposition from member states and non-harmonised national law to name a few. In the main part of his talk, Mr. Ritter gave an in-depth insight into the daily work of the EPPO and the special role it plays in the fight against transnational organised crime to the detriment of the European Union’s financial interests. The captivating lecture was enriched by numerous highly topical anecdotes Mr. Ritter shared about the operational reality of the EPPO.
Before the event progressed into a lively discussion, Mr. Ritter outlined some perspectives being discussed for the future of the EPPO, such as an expansion of the competences to other fields of crime such as the prosecution of transnational terrorism, transnational environmental crimes and international cybercrime but also the presently debated issue of the offence of circumventing sanctions imposed by the EU.
In the discussion that followed, the audience had the opportunity to delve deeper into what had been presented and beyond. Contributions ranged from fundamental questions about the role of the EPPO and the collaboration with national prosecution authorities to highly specific legal aspects of the work of the EPPO such as the competent judge for investigative measures in cases concerning multiple member states.
Jonathan Macziola
Bericht Gastvortrag Prof. Dr. Schloenhardt

Im Rahmen der Gesprächsreihe „Internationales Strafrecht“ war am 15.12.22 Professor Dr. Andreas Schloenhardt bei uns zu Gast. Prof. Schloenhardt ist Professor für Strafrecht an der University of Queensland in Brisbane, Australien und Honorarprofessor für ausländisches und internationales Strafrecht an der Universität Wien. Sein Vortrag trug den Titel „Plantdaddies and Trophyhunters“ und befasste sich mit dem illegalen Tier- und Pflanzenhandel; einem seiner aktuellen Forschungsschwerpunkte.
Prof. Schloenhardt leitete seinen Vortrag mit einem allgemeinen Überblick über den illegalen Tier- und Pflanzenhandel, seine Eigenschaften und Auswirkungen ein. Es handelt sich um einen global vernetzten Markt, der schätzungsweise zwischen 5 und 20 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr generiert. Seine negativen Folgen sind ebenso vielfältig wie gravierend: Er trägt zum Artensterben und dem Rückgang der Biodiversität bei, geht mit Tierquälerei, Ressourcenerschöpfung und der Bildung von Zoonosen einher und wird häufig von Gewalt, Bedrohungen und Korruption begleitet.
Prof. Schloenhardt berichtete dann über bereits bestehende internationale Abkommen gegen den illegalen Tier- und Pflanzenhandel, insbesondere im Bereich des Umweltschutzes und der Handelsregulierung. Am bekanntesten ist das CITES-Abkommen, das den Import und Export von geschützten Arten reguliert. Wenngleich es die Vertragsstaaten grundsätzlich verpflichtet, den Handel mit vom Aussterben bedrohten Arten zu untersagen, so enthält das Abkommen doch zahlreiche Ausnahmen und Schutzlücken, die von Kriminellen ausgenutzt werden. Strafrechtliche Abkommen gibt es bis dato nicht.
Der letzte Teil des Vortrags drehte sich um die Frage, ob ein neues internationales Abkommen zur strafrechtlichen Regulierung des illegalen Tier- und Pflanzenhandels abgeschlossen werden sollte, das Kriminalisierungspflichten enthält und die Kooperation der Strafverfolgungsbehörden stärkt. Diese Idee wird seit einigen Jahren unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Prof. Schloenhardt stellte uns einige dieser Ansätze vor – der wohl populärste ist der Vorschlag der „Global Initiative to End Wildlife Crime“, der die Schaffung eines neuen Zusatzprotokolls zur United Nations Convention against Transnational Organised Crime (sog. Palermo-Konvention) vorsieht. Prof. Schloenhardt wies dabei auf die Vorteile eines solchen Zusatzprotokolls hin - insbesondere die erleichterte Umsetzbarkeit durch die Anbindung an die Palermo-Konvention und die Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten und Strafvorschriften -, äußerte aber auch Bedenken: So wird die Kriminalisierung das Kernproblem - die hohe Nachfrage nach bedrohten Arten - nicht bekämpfen, zudem würde es durch die unterschiedliche Umsetzung in den Vertragsstaaten wieder zur Uneinheitlichkeit kommen, und schließlich mangelt es vielen Staaten am politischen Willen, das durchaus lukrative Geschäft mit bedrohten Tieren und Pflanzen konsequent zu unterbinden. Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob ein Konsens über ein strafrechtliches Abkommen gefunden werden kann und wenn ja, mit welchem Inhalt.
Im Anschluss an den Vortrag entstand eine lebhafte Diskussion über Sinnhaftigkeit, Umsetzbarkeit und Ausgestaltungsmöglichkeiten eines internationalen Abkommens, die bei Fingerfood und Getränken fortgesetzt wurde.
Lena Wasser
Gastvortrag Andrès Ritter

Das Institut für ausländisches und internationales Strafrecht lädt ein:
Gastvortrag von Andrés Ritter, German European Prosecutor and Deputy European Chief Prosecutor
Titel: The German Prosecutor at the European Public Prosecutor's Office.
Datum: 23.01.2023
Zeit: 10:00 Uhr
Ort: Cologne International Forum (International House, Kringsweg 6)
Wir bitten um kurze Anmeldung via internationales-strafrechtuni-koeln.de
Besuch Prof. Dr. Avlana K. Eisenberg

Im Oktober besuchte uns Prof. Dr. Avlana K. Eisenberg, die an der Florida State University aus strafrechtlicher und kriminologischer Perspektive unter anderem zu Hassverbrechen und Strafvollzug forscht. Über diese Forschung berichtete sie zum Abschluss ihres Besuchs im Rahmen des Vortrags „Addressing the Trauma of Hate Crimes“.
Strafen für Hasskriminalität gibt es in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene und in den meisten Bundesstaaten. Hasskriminalität bedeutet die Kombination eines Verbrechens, z.B. einer Körperverletzung oder eines Totschlags, mit einem diskriminierenden Motiv, wobei die in den Strafgesetzen normierten diskriminierenden Merkmale – wie Rasse, Behinderung oder Geschlecht – und die Anforderungen daran, wie sich dieses diskriminierende Merkmal ausdrückt – z.B. als Motivation für die Tat oder lediglich durch die Auswahl des Opfers – variieren. Schließlich können Hassverbrechen entweder als gesonderte Delikte oder als Ergänzung zu bereits bestehenden Straftaten bestraft werden.
Diese Regelungsstruktur begründet Zweifel daran, ob die Bestrafung von Hasskriminalität zu mehr Gleichberechtigung und Toleranz in der Gesellschaft führen kann, wie es sich die Befürworter der Regelungen erhoffen. Angesichts ohnehin hoher Strafen für Delikte wie Körperverletzung oder Totschlag kann einer zusätzlichen Freiheitsstrafe für das diskriminierende Element der Tat die normdurchsetzende Kraft fehlen. Darüber hinaus sind Täter von Hassverbrechen häufig Überzeugungstäter, die diskriminierenden Ideologien anhängen und international vernetzt sind. „Spektakuläre“ Hassverbrechen und die darauf folgende Berichterstattung – auch über Strafverfahren zur Aufklärung der Verbrechen – dienen als Inspiration und Motivation für andere Täter, auch über Ländergrenzen hinweg. Schuldspruch und Strafe erfüllen, so Prof. Eisenberg, nicht ihren Zweck (Abschreckung), sondern bewirken das Gegenteil: Ansporn. Am Beispiel des Falls Ahmoud Arbery – ein Schwarzer Mann, der in Georgia von drei weißen Männern getötet wurde – erläuterte Prof. Eisenberg schließlich, wie rassistische Strukturen in Polizei und Justiz die Verfolgung von Hasskriminalität weiter erschweren.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Hasskriminalität auf klassischem Weg schlug Prof. Eisenberg „restorative justice“, also – je nach Modell – eine Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer eines Hassverbrechens, als Alternativmodell vor. Dieser Vorschlag gab auch den Anstoß zur anschließenden Diskussion: Sollten es gerade die – in der Regel gegen Minderheiten oder gesellschaftlich unterdrückte Gruppen begangenen – Hassverbrechen sein, für die man das stärkste Mittel des Staates, das Strafrecht, durch restorative justice – Alternativen ersetzt? Wie wird bei restorative justice die expressive Funktion des Schuldspruchs, die für die Befürworter von Hasskriminalitätsgesetzen so wichtig ist, gewährleistet – gerade auch über die eigenen Landesgrenzen hinaus? Der Vorschlag, sich vergleichend mit ähnlichen Ansätzen zur Aufarbeitung des Apartheid-Regimes in Südafrika auseinanderzusetzen, bereicherte die Veranstaltung um ein weiteres internationales Element.
Laura Midey